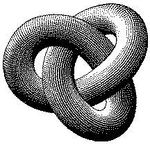Speicherung und Logistik
Für die Speicherung von Wasserstoff bieten sich verschiedenste Verfahren an, die mit Sicherheit alle ihren Platz in einer wachsenden Wasserstoffwirtschaft haben werden.
VAWT-Engineering favorisiert bei Speicherung und Logistik die Bindung von Wasserstoff in sogenannten Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC) – einem Kohlenwasserstoff, der als wiederverwendbares Trägermaterial für die Speicherung von Wasserstoff bei Umgebungsbedingungen dient. So gebunden kann Wasserstoff risikolos und in großen Mengen dauerhaft gespeichert und weltweit transportiert werden. Unter Verwendung der bestehenden Infrastruktur für Diesel / Benzin kann Wasserstoff so unter Umgebungsdruck (p = 1 bar) und Normaltemperatur (T = 20° C) beliebig lange gelagert und an jeden Ort transportiert werden. In 1 m³ LOHC lassen sich bis zu 57 kg = 660 Norm m³ Wasserstoff speichern und transportieren.
Stationäre Anwendung
Klassische Wärmeerzeuger wie Gas- oder Ölheizungen und auch elektrische Heizer können in Haushalten, Industrie und Gewerbe in einer wärmegeführten Wasserstoffwirtschaft durch eine Brennstoffzellenheizung mit Warmwasserbereitung ersetzt werden. Auch im Sommer wird bei den meisten Anwendern mehr Wärme / Kälte als Strom benötigt. Da die Brennstoffzelle beide Energieformen im Verhältnis 1:1 produziert geht kaum Wärme ungenutzt verloren. Nicht nur bei hohem Wärme- / Kältebedarf wird ein Stromüberschuss generiert, der in Batterien gespeichert, zum Laden von Elektromobilen genutzt oder hoch effektiv mittels Wärmepumpe in Wärme / Kälte umgewandelt werden kann, was wiederum die Baugröße der Brennstoffzelle und den Wasserstoffverbrauch reduziert.
Bei konsequenter Anwendung von Kaskadenanlagen kann mit einer solchen wärmegeführten Brennstoffzellenanlage eine Auskoppelung aus bestehenden Versorgungsnetzen bei hoher Versorgungssicherheit umgesetzt werden. Die einzig limitierende Größe ist der gespeicherte Wasserstoffvorrat.
Bei einer Wärmegeführten Brennstoffzelle können mit 100 kg Wasserstoff, in der einfachsten Variante etwa 1.527 kWh thermisch und 1,527 kWh elektrisch genutzt werden.
Bei Einsatz eines elektrischen Heizstabes ist auch der elektrische Anteil nahezu vollständig thermisch nutzbar, also eine Leistung von 3.055 kWh thermisch möglich.
Beim Einsatz einer Wärmepumpe mit einem COP von 4 sind theoretisch 7.635 kWh thermische Leistung möglich..